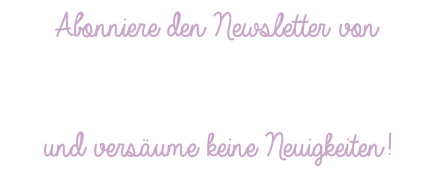Sonstiges
Warum Babys unter 2 Jahren keine Bildschirmzeit haben sollten – und wie man später gesund damit beginnt
- Details
Babys und Kleinkinder lernen in den ersten zwei Lebensjahren in einem atemberaubenden Tempo. Alles, was sie sehen, hören und mit ihrem Körper erleben, baut ihr Gehirn auf – im wahrsten Sinne des Wortes. Jede Berührung, jedes Geräusch, jedes Gesicht prägt die Verschaltungen zwischen Milliarden von Nervenzellen. Dieser Prozess ist so sensibel, dass Störungen in dieser Zeit langfristige Folgen haben können.
Warum keine Bildschirmzeit im Baby- und Kleinkindalter?
Studien zeigen, dass Babys vor Bildschirmen keine echten Lernerfahrungen machen. Sie sehen zwar bunte Bilder und hören Geräusche, aber ihr Gehirn kann diese Reizflut nicht sinnvoll verarbeiten. Die schnelle Abfolge von Szenen überfordert die noch unreifen Strukturen, besonders im präfrontalen Kortex, der für Selbstkontrolle, Aufmerksamkeit und Planung zuständig ist (Wu et al. 2023). Kinder brauchen hingegen eigene Körpererfahrungen – Greifen, Krabbeln, Schauen, Spüren – damit sich die neuronalen Schaltkreise gesund entwickeln (Hüther 2012). Digitale Inhalte wirken wie „Junkfood fürs Gehirn“ (Shanker 2019). Erst kommt der Energieschub, danach die Erschöpfung – und Kinder verlangen nach mehr. Abschalten führt oft zu Wutanfällen oder Rückzug. Dies zeigt sich besonders beim Abschalten oder Wegnehmen des Tablets, das bei vielen Kindern zu Frustration, Wut und Unruhe führt. Hinzu kommt: Viele Kinder verarbeiten die Inhalte im Schlaf. Dadurch verschlechtert sich die Schlafqualität – und damit wiederum Konzentration, Stimmung und Entwicklung (Spitzer 2012).
Auch Sprache lernt ein Kind nicht durch das passive Zuhören bei Serien oder Apps, sondern durch echtes Gespräch. Babys müssen sehen, wie sich der Mund beim Sprechen bewegt, sie brauchen Blickkontakt, Gestik und Reaktionen. Mehrere Studien belegen, dass schon 30 Minuten Bildschirmzeit täglich das Risiko einer Sprachentwicklungsverzögerung deutlich erhöhen (AAP 2017; Zimmermann et al. 2007). Kinder, die regelmäßig fernsehen oder Apps nutzen durften, kannten und benutzten im Alter von zwei Jahren signifikant weniger Wörter als Gleichaltrige. Eine aktuelle australische Studie (Brushe et al. 2024) zeigt zudem: Mit jeder zusätzlichen Bildschirmminute hörten Kleinkinder weniger gesprochene Worte von Erwachsenen und sprachen auch selbst weniger. Das führt nachweislich zu weniger Gesprächen innerhalb der Familie und kann langfristige Folgen für die Sprachentwicklung aber auch auf das Verhalten der Kinder haben.
Besonders zu beachten ist auch der so genannten “virtuelle Autismus”: Kinder, die in den ersten Jahren viel Bildschirmzeit haben, zeigen häufiger Symptome, die einem Autismus ähneln – wie Spracharmut, Rückzug und mangelnde Empathie. Expert*innen sprechen hier von „Pseudo-Autismus“ oder “virtuellen Autismus”, da diese Symptome nicht genetisch, sondern durch fehlende soziale Interaktion in den frühen Jahren entstehen (Heffler et al. 2020). Gute Nachricht: Wird der Bildschirmkonsum reduziert und die Eltern-Kind-Interaktion gestärkt, können sich diese Fähigkeiten erholen.
Fazit: Babys unter zwei Jahren gehören nicht vor Bildschirme. In dieser sensiblen Phase brauchen sie echte Erfahrungen, Sprache von Menschen und vor allem: Zeit mit ihren Liebsten für die optimale Entwicklung.
Wie kann man nun den Einstieg in die Mediennutzung gesund gestalten?
Irgendwann kommt für alle Familien der Punkt, an dem Medien eine Rolle spielen – sei es durch ältere Geschwister, bei den Großeltern oder im Kindergarten. Entscheidend ist, wie Eltern den Einstieg begleiten.
Die oberste Regel lautet: Medien dürfen niemals zum Babysitter werden. Gemeinsames Schauen bedeutet, dass ein Elternteil daneben sitzt, auf die Inhalte reagiert, diese erklärt und dannach gemeinsam das Video besprochen wird. Man kann zum Beispiel fragen “Wie fühlt sich die Figur XY gerade? Ist sie traurig oder fröhlich?” und “Warum glaubst du ist sie gerade traurig?” und den Inhalt in 2-3 Sätzen kurz zusammenfassen: "Was hast du gesehen?“, „Wie fandest du das?“ und “Was hat dir am Besten gefallen?”. Nur so können Kinder Inhalte verarbeiten und mit der Realität verknüpfen. So wird die Sprachentwicklung gefördert, die Verarbeitung unterstützt und eure Bindung gefestigt.

Im Internet liest man Empfehlungen wie „30 Minuten pro Tag sind erlaubt“. Doch jedes Kind reagiert anders und diese Richtlinien sind nur grobe Empfehlungen. Eltern sollten beobachten:
- Ist mein Kind nach dem Schauen aufgeregt oder überdreht?
- Wird es wütend beim Abschalten?
- Zieht es sich zurück?
- Kann es wiedergeben, was es gesehen hat?
Diese Reaktionen sind wichtiger als jede Zeitangabe. Hier gilt: Entwicklung und Tagesverfassung über Minuten-Empfehlungen. Wenn Kinder um das zweite oder dritte Lebensjahr erste Medienerfahrungen machen, reicht ein Einstieg von 5–10 Minuten täglich völlig aus.
Wichtig ist zudem Ruhezeiten fürs Gehirn aktiv einzuplanen. Nach dem Schauen braucht das Gehirn Pause. Keine zweite Serie direkt hinterher, sondern Zeit für freies Spiel, Bewegung oder ein Gespräch. So können die vielen Eindrücke sortiert und ins Gedächtnis integriert werden. Das Gehirn ist nach einer Folge sowieso schon komplett überreizt - man muss immer bedenken, dass Kinder erst im Alter von rund 6 Jahren Bilder und Töne zeitgleich verarbeiten können. Das heißt auch, dass Videos kaum im Kontext wahrgenommen werden und eigentlich nur eine dauerhafte Reizüberflutung darstellen - klar das man dannach überdreht ist und Ruhe und Zeit braucht!
Nicht alles, was bunt und als „kindgerecht“ verkauft wird, ist wirklich geeignet. Gerade schnelle Serien wie Paw Patrol sind viel zu schnell für Kinder. Kurze Clips mit schnellen Bildwechseln überfordern das kindliche Gehirn besonders stark. Empfehlenswert sind ruhige Inhalte mit wenig Schnitten, klarer Sprache und positiven Botschaften, ein Beispiel ist da Biene Maja, Peterson und Findus, Pingu oder Puffin Rock. Zu beachen ist auch, dass Youtube Kids nicht nur kindergerechte Inhalte anzeigt, sondern im Gegenteil solche, die Aufmerksamkeit erregen. Lade daher besser Videos herunter und lasse dein Kind sie offline schauen - so vermeidest du verstörende Inhalte und Werbung!

So machst du es am Besten
Stell dir vor, dein Kind darf zum ersten Mal eine kleine Serie sehen. Statt es alleine vor den Fernseher zu setzen, setzt du dich dazu. Nach fünf Minuten schaltest du aus und fragst: „Was hast du gesehen?“ oder „Welche Figur hat dir gefallen?“ – So förderst du Sprache, Dialog und Verständnis. Danach geht ihr gemeinsam in den Garten oder spielt mit Bauklötzen. Das Gehirn kann die neuen Eindrücke in Ruhe verarbeiten – und dein Kind hat beides: Medienerlebnis UND die echte Welt mit echten Erfahrungen!
Digitale Medien gehören zu unserer Welt – auch Kinder werden ihnen begegnen. Doch der richtige Zeitpunkt und die Art des Einstiegs entscheiden, ob sie Schaden anrichten oder in Maßen bereichern können.
Unter zwei Jahren heißt es: Hände weg vom Bildschirm. Danach gilt: Wenig, gemeinsam, bewusst – und immer im Blick, wie dein Kind reagiert.
Über die Autorin
Kathrin Habermann ist Ergotherapeutin und möchte in ihren Büchern und Vorträgen sowohl die positiven als auch negativen Seiten der Nutzung digitaler Medien beleuchten. Ihr Ziel ist es, aufzuzeigen, wie man digitale Medien sinnvoll nutzen kann und worauf man im Umgang achten soll.
Mehr Infos auf der Website medienbegleiten.at oder auf Instagram.