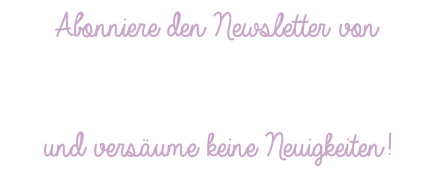Sonstiges
Zwischen Halt und Hilflosigkeit - Elternschaft im Spannungsfeld des PDA-Konzepts
- Details
Gastautorin Viktoria Kindermann, Psychologin und Pädagogin, möchte mit diesem Beitrag zu einer fachlich fundierten und respektvollen Auseinandersetzung mit dem Thema "Pathological Demand Avoidance" anregen.

Ich schätze Nora Imlau für ihre fundierte, beziehungsorientierte Haltung und ihre Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu machen. Ihr Buch „Meine Grenze ist dein Halt“ empfehle ich Eltern oft, weil es eine Grundwahrheit jedes Miteinanders auf den Punkt bringt: Kinder brauchen Erwachsene, die Orientierung geben, halten und Grenzen klar, liebevoll und verlässlich gestalten. Grenzen sind keine Gegensätze zu Beziehung, sondern ihre Voraussetzung. Sie geben Sicherheit und Vorhersehbarkeit.
Was ist PDA - Pathological Demand Avoidance?
Gerade deshalb ist es mir wichtig, beim derzeit viel diskutierten Thema PDA (Pathological Demand Avoidance) genau hinzuschauen. Das in Fachkreisen kontrovers diskutierte Konzept beschreibt ein Verhaltensmuster, bei dem Kinder auf Anforderungen mit massiver Vermeidung, Widerstand oder Angst reagieren. Oft so stark, dass der Alltag zur Dauerbelastung wird. Als zentrale Ursache wird eine ausgeprägte Angst vor Kontrollverlust und Unvorhersehbarkeit angenommen. Verhaltensempfehlungen sollen helfen, Überforderung zu vermeiden und Sicherheit zu schaffen. Eine davon lautet, Anforderungen zu reduzieren und anzupassen - nicht sie völlig aufzugeben. In der Praxis aber wird aus Anpassung manchmal unbeabsichtigt Aufgabe.
Nora Imlau hat das Thema kürzlich aufgegriffen und betont, dass vieles an PDA noch erforscht werden müsse, der Leidensdruck der Familien jedoch real sei. Das sehe ich genauso: Diese Familien sind hoch belastet und verdienen Verständnis und tragende Unterstützung. Die Schwierigkeit liegt darin, aus dieser Sorge nicht den falschen Schluss zu ziehen und Anforderungen immer weiter zurückzunehmen. Denn was als Entlastung gedacht ist, entzieht Kindern auf Dauer genau das, was sie am dringendsten brauchen: Orientierung, Struktur und Halt. Die Bindungsforschung weist darauf hin, dass Sicherheit durch Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit entsteht und nicht durch grenzenlose Anpassung oder den Versuch, jede Anforderung zu vermeiden.
Das Konzept spricht vor allem Eltern an, die Beziehung bewusst gestalten und feinfühlig begleiten wollen - ein Anliegen, das ich teile. Viele Verhaltensempfehlungen knüpfen an das Verständnis an, Beziehung als Kern gelingender Elternschaft zu sehen und wirken auf den ersten Blick wie eine Fortsetzung beziehungsorientierter Pädagogik: weniger Druck, mehr Verständnis. Diese Haltung ist wertvoll, doch aus dem Wunsch nach Feinfühligkeit entsteht leicht das Missverständnis, Bindung müsse sich immer leicht und harmonisch anfühlen. In Wahrheit ist sichere Bindung kein Zustand ständiger Übereinstimmung, sondern das Vertrauen, Spannungen gemeinsam zu bewältigen. Kinder brauchen Eltern, die Nähe anbieten und zugleich führen. Besonders Kinder, die stark auf Kontrollverlust reagieren, gewinnen Sicherheit nicht durch Konfliktvermeidung, sondern durch die Erfahrung, dass Beziehung auch in schwierigen Momenten trägt.

Zumutungen werden vermieden, statt begleitet
In meiner Arbeit als Psychologin und Pädagogin begegne ich immer wieder Familien, die sich darin wiederfinden. Viele Kinder stemmen sich gegen jede Anforderung, reagieren schon auf kleinste Erwartungen mit Angst oder Wut, während Eltern sich ohnmächtig fühlen. Oft kämpfen diese Familien nicht nur mit dem Verhalten der Kinder, sondern auch mit ihrer eigenen Angst, zu überfordern oder die Beziehung zu gefährden. So entsteht leicht ein Muster elterlicher Avoidance: Aus bester Absicht werden Zumutungen vermieden, statt begleitet. Doch genau das verunsichert Kinder: Spüren sie, dass Erwachsene ausweichen, versuchen sie selbst, etwa durch Rückzug oder Widerstand die Kontrolle zu übernehmen.
Zwei Missverständnisse begegnen mir immer wieder:
- Anforderungen werden oft mit Befehlen oder Machtausübung verwechselt. Dabei lässt sich klar und gleichzeitig in Beziehung sprechen, etwa: „Bitte schließ die Tür, es wird sonst kalt.“ Klarheit ist kein Gegensatz zu Feinfühligkeit, sondern Ausdruck von Verlässlichkeit.
- Es fällt den Eltern oft schwer zu unterscheiden, welche Erwartungen ihr Kind tatsächlich überfordern und wo eigene Sorgen mitschwingen. Kein Kind wird in seiner Integrität verletzt, wenn es freundlich gebeten wird, seine Jacke aufzuhängen oder beim Tischdecken zu helfen. Solche Anforderungen sind keine Zumutung, sondern Orientierungspunkte: Sie geben Kindern die Möglichkeit, sich als wirksam und eingebunden zu erleben.
Vor allem Kinder, die stark auf Kontrollverlust und Angst reagieren, brauchen keine grenzenlose Rücksicht, sondern verlässliche Führung. Struktur, Orientierung und Klarheit sind für sie kein Gegensatz zu Beziehung, sondern deren Voraussetzung. Sicherheit entsteht, wenn Kinder spüren, dass Erwachsene wissen, was zu tun ist und verlässlich bleiben, auch wenn es schwierig wird.
Indirekte Kommunikation - ein Widerspruch?
Ein zentraler Widerspruch zeigt sich in der oft empfohlenen „indirekten Kommunikation“.
Sätze wie „Die Tür wäre noch offen“ statt „Bitte schließ die Tür“ sollen deeskalierend wirken.
Die gängigen PDA-Handlungsempfehlungen gehen davon aus, dass PDA häufig bei Kindern im Autismus-Spektrum vorkommt, belastbare Daten dafür fehlen jedoch. Unabhängig davon stützen sich viele Empfehlungen auf genau diese Annahme und hier entsteht der eigentliche Widerspruch: Besonders Kinder im Autismus-Spektrum verstehen indirekte Sprache und Mehrdeutigkeit oft nicht zuverlässig. Was beruhigen soll, erzeugt so oft noch mehr Unsicherheit. Sprache ist für viele neurodiverse Kinder keine neutrale Information, sondern eine Quelle von Mehrdeutigkeit - und genau diese Ambiguität löst Stress aus. Kinder brauchen deshalb keine verklausulierten Botschaften, sondern klare, respektvolle und vorhersehbare Kommunikation. Klarheit ist kein Zwang, sondern Schutz und Orientierung.
Aus wissenschaftlicher Sicht sind zwei Punkte besonders kritisch:
- Die Datenlage ist schwach und widersprüchlich. Das Modell geht auf die britische Psychologin Elizabeth Newson zurück, die in den 1980er-Jahren ein bestimmtes Verhaltensmuster bei Kindern beschrieb und als eigenständiges Syndrom verstand. Eine Annahme, die bis heute kaum systematisch überprüft wurde. Es gibt keine klar definierten diagnostischen Kriterien; die wenigen Studien beruhen auf kleinen, selektiven Stichproben, in denen andere mögliche Diagnosen kaum berücksichtigt wurden. Entsprechend fehlt belastbare Evidenz, dass PDA ein eigenständiges Störungsbild oder ein eigenständiger Subtyp innerhalb des Autismusspektrums ist. Die beschriebenen Verhaltensweisen lassen sich durch die Symptomatik bestehender Diagnosen erklären.
- Die pädagogisch-therapeutischen Ansätze werfen Fragen auf. Zentral sind die sogenannten PANDA-Strategien: Pick Battles, Anxiety Management, Negotiation & Collaboration, Disguise & manage Demands, Adaptation. Darin finden sich hilfreiche Elemente wie Mitbestimmung und Sicherheit, andere - etwa das starke Reduzieren oder „Maskieren“ von Anforderungen - bergen Risiken. Zu indirekte Kommunikation kann Unsicherheit verstärken; verschleierte Erwartungen mindern Authentizität, und Kinder spüren das sofort. Hilfreich ist, wenn Kinder innerhalb klarer Strukturen Wahlmöglichkeiten erhalten: Erwachsene bestimmen das Was, Kinder gestalten das Wie mit.
Keine einheitliche, international gültige Diagonose
Trotz seiner langen Geschichte wurde PDA in keines der internationalen Diagnosemanuale aufgenommen - weder in das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) noch in die International Statistical Classification of Diseases and Related Health Disorders (ICD). Das liegt nicht an Versäumnissen, sondern daran, dass PDA kein eigenständiges Störungsbild darstellt, sondern ein beschreibendes Verhaltensmuster, wie es etwa bei Autismus, ADHS, FASD (Fetale Alkoholspektrumstörung), Angst- oder Traumafolgestörungen vorkommen kann. Zu sagen, ein Kind habe „Autismus mit PDA“, ist daher in etwa so, als würde man sagen: „Ich habe Grippe mit Erkältungssymptomen.“ Das beschreibt etwas Reales, aber nichts Eigenständiges und nichts, das auf eine zugrunde liegende Diagnose beschränkt wäre.

Wenn Verhalten vorschnell als „PDA“ bezeichnet wird, geraten Diagnosen und Hilfsangebote leicht in Schieflage. Kinder mit Autismus, ADHS oder anderen Entwicklungsbeeinträchtigungen werden womöglich nicht korrekt diagnostiziert; umgekehrt werden bestehende Diagnosen möglicherweise bagatellisiert. Ebenso riskant wird es, wenn normales, altersgerechtes Autonomiestreben pathologisiert wird. Ein Kind, das lernt, sich abzugrenzen, gilt plötzlich als „vermeidend“, statt als jemand, der Selbstwirksamkeit entwickelt. So verschwimmt die Grenze zwischen Entwicklung und Störung, mit dem Risiko, dass Kinder „therapeutisiert“ werden, wo eigentlich Halt und Beziehung gefragt wären.
Für Eltern entsteht daraus oft Verunsicherung. Aus Sorge, ihr Kind zu überfordern oder die Beziehung zu gefährden, ziehen sie sich unbewusst aus ihrer Erziehungsverantwortung zurück. Was als Entlastung gemeint ist, wird zur Belastung: Kinder verlieren Orientierung, weil alles Rücksicht, aber nichts mehr Richtung ist. Sie brauchen Erwachsene, die präsent bleiben, Nähe anbieten und zugleich leiten - ruhig, klar und verlässlich.
Ich verstehe gut, warum viele Eltern sich von PDA angesprochen fühlen. Die Belastung betroffener Familien ist groß, und wenn es plötzlich Worte für etwas gibt, das sich chaotisch anfühlt, kann das alleine schon entlasten. Doch diese Familien brauchen Verständnis und echte Unterstützung, nicht Empfehlungen, die verunsichern und Eltern das Vertrauen in ihre eigene Kompetenz nehmen. Wenn wir beginnen, jedes Nein oder Kontrollbedürfnis als pathologisch zu sehen, nehmen wir Kindern die Chance, Frustrationstoleranz und Selbstwirksamkeit zu entwickeln.
Elterlicher Halt bedeutet nicht, jede Zumutung zu vermeiden, sondern sie gemeinsam zu bewältigen. Kinder brauchen mehr als bloßes Verständnis - sie brauchen Erwachsene, die sich nicht von Angst leiten lassen, sondern vom Vertrauen in ihre eigene Beziehungskompetenz. Zwischen Halt und Hilflosigkeit entscheidet sich, ob Begleitung gelingt. Denn Kinder wachsen nicht an grenzenloser Rücksicht, sondern an verlässlicher Beziehung.
Über die Autorin

Mag. Viktoria Kindermann ist Psychologin und Pädagogin. Sie begleitet Familien bindungs- und beziehungsorientiert in herausfordernden Entwicklungsphasen und bei Regulations- und Bindungsthemen – insbesondere von Schwangerschaft bis ins frühe Schulalter, wenn Unsicherheit, Überforderung oder Krisen Momente von Nähe und Verbindung erschweren.
Weitere Infos unter www.fraukindermann.at